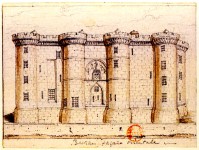Es geht um den gesundheitlichen Schutz des Nichtrauchers vor dem Rauch der Raucher - und um nichts anderes.
Dies ist das schlichte und einfache Hauptargument, mit dem viele Menschen zur Überzeugung kommen, ein
Totalverbot des Rauchens in Lokalen, Restaurants, Cafés und Bars sei gut argumentierbar - ja vielleicht sogar die
wahrhaft "liberale" Lösung zum allgemeinen Besten, schliesslich könne eine oftmals postulierte, aber eben nicht argumentierbare "Freiheit zu Rauchen" niemals auf Kosten der Freiheit des Nächsten gehen, keinen Rauch einatmen zu wollen.
Klingt das stimmig?
Und wenn ja, rechtfertigt das aber wirklich ein Totalverbot in Lokalen, Restaurants, Cafés und Bars? Recht weitgehend unbestritten und auch seit langem meine Position ist es, dass in eindeutig und jeder Hinsicht
öffentlichen Räumen (Schulen, Ämtern, Verkehrsmitteln, Krankenhäusern, etc...) ein totales oder sehr sehr weitgehendes Rauchverbot tatsächlich die einzig angemessene Lösung ist. Nichtraucher können diese Bereiche öffentlichen Lebens keinesfalls umgehen, sie haben keinerlei Wahl - keine Wahl etwa ihren Führerschein auf einem eigenen Verkehrsamt für Nichtraucher abzuholen - das Bedürfnis des Rauchers nach jederzeitiger freien Entfaltung all seiner rationalen und irrationalen Bedürfnisse muss demgegenüber wohl zurücktreten. Dem Raucher in diesem Fall seine Freiheit zu gewähren schränkt die Freiheit des Nichtrauchers, den Rauch nicht einatmen zu müssen, in unzulässiger Weise ein.
Wie kommt die informierte und
freiheitsliebenden Argumenten gegenüber durchaus
aufgeschlossene Nichtraucherfraktion (ja, die gibts und sie ist auch die einzige Fraktion mit deren Argumenten ich mich in Folge auseinandersetzen möchte) nun aber zur Überzeugung, dass
auch im Bereich der Lokale, Restaurants, Cafés und Bars ein
Totalverbot die
gebotene Lösung sei? Wäre es nicht durchaus legitim, wenn es neben einer grossen Anzahl an Nichtraucherlokalen auch eine gewisse Anzahl an Raucherlokalen gäbe? Sollte man nicht eine Kompromisslösung im Wege von Teilverboten und diversen nichtraucherfreundlichen Betriebsauflagen für Lokale suchen? Sollte es nicht im Bereich sehr kleiner Lokale, die keine Raumtrennung vornehmen können, eine Wahlfreiheit für die Lokalinhaber geben - und könnte das Problem im übrigen nicht einfach dem Markt überlassen bleiben? Gibt es eben vielleicht einfach keine reale Nachfrage nach Nichtraucherlokalen?
Nun, das einfache Argument der Nichtraucherfraktion lautet dann meist,
die Wahlfreiheit der Lokalinhaber habe eben
nicht "zum Erfolg" geführt. Wobei: mit "Erfolg" wird in diesem Fall wohl niemals gemeint gewesen sein, dass ALLE Lokale freiwillig und komplett auf "rauchfrei" hätten umstellen müssen, um das Ergebnis in den Augen der aufgeschlossenen Nichtraucherfraktion als "Erfolg" gelten lassen zu können. Nein, gemeint war wohl hier immer, dass das Angebot an rauchfreien Lokalen leider nach wie vor weitgehend inexistent sei. Nun, auch diesem Argument bin ich zunächst mit einer gewissen Portion Skepsis entgegengetreten, denn immerhin könnte man ja auch meinen, dass es trotz heftiger öffentlicher Debatten bisher einfach kaum reale Nachfrage nach Nichtraucherlokalen gab: für den Nachweis einer solchen Nachfrage reicht es nämlich nicht, aufzuzeigen, dass es wesentlich weniger Plätze in Nichtraucherlokalen gibt als Nichtraucher - entscheidend ist ja vielmehr, ob die Nichtraucher selbst tatsächlich ein Nichtraucherlokal WOLLEN und aktiv bervorzugen.
Überzeugend ist allerdings folgendes: es lässt sich aufzeigen, dass die Nichtraucher in diesem Markt, selbst dann, wenn sie ein Nichtraucherlokal besuchen WOLLEN, in einer
systematischen Verliererposition gefangen sind: der Nichtraucher kann sein Konsumverhalten mit Bezug auf Lokale nicht einfach durch blosse Auswahl treffen - so wie das bei der simplen Auswahl zwischen roten und grünen Äpfeln ganz einfach der Fall wäre - sondern sein Wunsch nach einer ausreichenden Anzahl von rauchfreien Lokalen würde erst dann vom Markt zunehmend bedient werden, wenn er von der Fraktion der toleranten Nichtraucher in die Fraktion der intoleranten Nichtraucher wechseln würde - mit allen damit verbundenen sozialen Konsequenzen: nur der intolerante Nichtraucher hat eine gewisse Marktmacht, der tolerante Nichtraucher nahezu keine. Es ist die Toleranz des durchschnittlichen Nichtrauchers, die dazu führt, dass sich die Angebotsseite in diesem Markt nur zu sehr zögerlicher Anpassung veranlasst sieht, denn sie kann als "Raucherlokal" ja diese beiden Gruppen problemles bedienen: die Raucher sowieso und die grosse Menge der toleranten Nichtraucher eben auch. Vergleicht man diese Nachfragesituation der Nichtraucher aber mit der Situation auf dem Markt für zB rote und grüne Äpfel, dann hätte der Nachfrager grüner Äpfel gewissermassen erst dann eine reale Chance, grüne Äpfel auch angeboten zu bekommen, wenn er dazu aktiv darauf bestehen müsste, dass in Apfelläden keine roten Äpfel mehr angeboten werden. Da nur wenige Liebhaber grüner Äpfel dieser absurden Forderung gemäss so "intolerant" gegenüber den Liebhabern roter Äpfel sein werden wollen, werden sie im Zweifel eben zur Kenntnis nehmen, dass grüne Äpfel für freundliche Menschen eben kaum zu haben sind - und in den roten Apfel beissen, der im Fall der Raucherlokale zudem ein "schleichend vergiftender" Apfel ist...
Dieser Markt hat daher sozusagen "Lungenkrebs", oder ganz simpel: er
funktioniert nicht zufriedenstellend. Er benötigt einen Eingriff, der sicherstellt, dass er wieder das zu leisten imstande ist, was wir eigentlich von ihm wollen: reale Wahlfreiheiten herzustellen.
Der Weg auf dem die informierte und liberalen Argumenten durchaus aufgeschlossene Nichtraucherfraktion von der Erkenntnis eines nicht funktionierenden Markts schnurstracks zur
Forderung nach einem Totalrauchverbot gelangt, ist ebenfalls interessant und ebenfalls
nachvollziehbar: Die bestehende Wahlfreiheit des Konsumenten habe nachweisbar (und ich füge hinzu: aufgrund der systematischen Verliererposition der toleranten Nichtraucher) nicht zu einer ausreichenden Anzahl rauchfreier Lokale geführt. Das Konzept von Teilverboten und räumlicher Trennung könnte zwar prinzipiell akzeptabel sein, funktioniere aber leider nur für ausreichend grosse Lokale einigermassen zufriedenstellend. Da sich kleine Lokale in Folge für Raucher bzw. Nichtraucher entscheiden müssten, bestünde die Gefahr, dass sie sich aufgrund antizipierter Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Lokalen (und wiederum aufgrund der systematischen Verliererposition toleranter Nichtraucher) in grosser Mehrheit wiederum für die Deklaration als Raucherlokal entscheiden müssten. Dies scheint plausibel zu sein. Und die weitere Konsequenz daraus ist dann aber die Forderung nach dem Totalverbot des Rauchens in Lokalen, Restaurants, Cafés und Bars. Denn dies sei die einzige Position, die dem Nichtraucherschutz gerecht werde und gleichzeitig die
durch Teilverbote fast
zwangsläufig entstehenden Wettbewerbsverzerrungen ausschliesse. So sei insbesondere schlecht akzeptabel, dass kleinen Lokalen ein Totalverbot auferlegt werde, während grosse Lokale mit einem gemischten Angebot auftrumpfen könnten. Ein
nobles, vor allem ein
richtiges Argument, wie ich meine.
Wir halten aber an dieser Stelle penibel fest:
Hätte der Markt eine der Nichtraucherfraktion zur Befriedigung ihrer Nachfragebedürfnisse
"ausreichend grosse" Anzahl an Nichtraucherlokalen zur Verfügung gestellt, wäre der Forderung nach einem Totalverbot einer ihrer wesentlichsten Grundlagen entzogen. Dasselbe gilt meines Erachtens auch für den Arbeitnehmerschutz:
Stünde eine
"ausreichend grosse" Anzahl an Nichtraucherlokalen zur Verfügung, die es jeder nichtrauchenden Kellnerin und jedem nichtrauchenden Barkeeper auf Wunsch ermöglicht, in einem Lokal für Nichtraucher zu arbeiten, wäre der Forderung nach einem Totalverbot eine ihrer wesentlichsten Grundlagen entzogen. Und schliesslich gilt ähnliches für das Argument, Nichtraucher müssten auch in so einer Welt mit einer ausreichenden Anzahl an Nichtraucherlokalen uU immer noch ihre sozialen Kontakte mit Rauchern in Raucherlokalen pflegen: Stünde diese "ausreichend grosse" Anzahl an Nichtraucherlokalen zur Verfügung, die eine freie Wahl ermöglicht, dann kann der liberale Geist es der dann real freien Vereinbarung zwischen Raucher und Nichtraucher überlassen, ob der Raucher in Gegenwart des Nichtrauchers rauchen darf und auf welchen Lokaltyp die gemeinsame Entscheidung fällt. Die Gestaltung des Sozialkontakts mit Rauchern ist schlussendlich eine Frage, der sich Nichtraucher auch im nicht-öffentlichen Bereich stellen müssen: zB indem sie die gemeinsame Entscheidung fällen, ob man einander in der Wohnung des Rauchers trifft, in der dieser in Gegenwart des Nichtrauchers rauchen wird, oder aber in der Wohnung des Nichtrauchers, in der der Raucher auf Wunsch des Nichtrauchers vielleicht vor der Tür rauchen wird müssen.
"Hättiwari", ich weiss. Ich anerkenne aber also die Argumente für das Totalverbot und unterstelle trotz meines reisserischen Titels
keine pseudoreligiöse Bewegung für das 11. Gebot des 21. Jahrhunderts. Akzeptierte ich aber das Totalverbot, bliebe ein echtes
Unbehagen mit einigen Konsequenzen zurück und daraus resultiert mein Nachdenken, ob es nicht eine
bessere Lösung als dieses Totalverbot geben könnte. Eine Lösung, die genau diese beschriebene "ausreichend grosse" Anzahl an Nichtraucherlokalen
zur Verfügung stellen könnte.